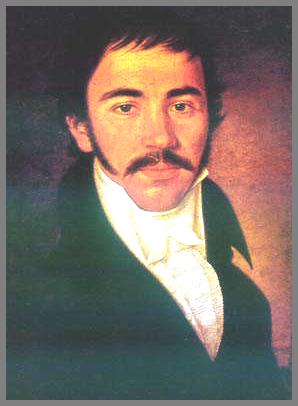
Biographisches Stichwort
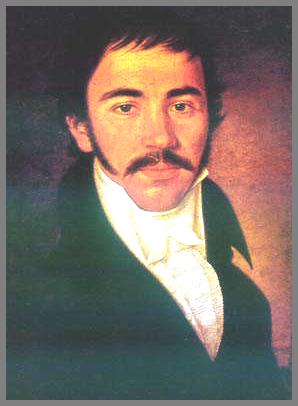
Vuk Stefanovic
Karadzic (auch Karadschitsch), am 6. November 1787 (nach dem alten Kalender am
26. Oktober) in Trsic bei Loznica als Sohn eines Bauern geboren, lernte das
Schreiben noch mit einem zugespitzten Zweig, den er in aufgelösten Ofenruß
tauchte. Später besuchte er die Schule in Karlowicz, ging dann nach Wien und
wurde während der serbisch-türkischen Kämpfe Sekretär verschiedener Führer
seines Volkes. Nach
dem Zusammenbruch des serbischen Aufstands floh er nach Wien, wo ihn der Slawist
Kopitar zur intensiven Beschäftigung mit der serbischen Schriftsprache anregte.
Karadzic war eine der großen
Persönlichkeiten der serbischen Geschichte. Er erforschte und reformierte die
serbische Sprache, gab eine Grammatik (1814) und ein Wörterbuch (1818) des
Serbischen heraus und sammelte serbische Volkslieder, die er in zehn Bänden
veröffentlichte. Im Jahre 1847 erschien seine Übersetzung des Neuen Testaments
ins Serbische. Karadzic starb am 7. Februar (26. Januar) 1864 in Wien, 1897 wurden seine sterblichen
Überreste nach Belgrad überführt.
In seinem Aufsatz "Serbische Lieder" hat Goethe Karadzic lobend erwähnt.
Zu den verschiedenen Schreibungen des Namens:
Da es damals in seiner Heimat nicht Sitte war, einen Familiennamen zu
führen, hieß er mit seinem Vor- und Vatersnamen zunächst nur Vuk Stefanovic
(auch: Wuk Stephanowitsch), d.h. Wolf, des Stefans Sohn. Deshalb findet man in
der älteren Literatur hin und wieder den Namen Wolf Stephansohn. Erst später,
so Wurzbach, "nahm er nach dem Orte, wo seine Eltern ein Anwesen besaßen,
den Namen Karadschitsch an und machte sich unter demselben in der
wissenschaftlichen Welt bald in ausgezeichneter Weise bekannt". Aber auch
dieser Name begegnet uns in den verschiedensten Formen: Karadzic, Karadschitsch,
Karacic, Karadzitsch, Karagich, Karajich usw. Wer in elektronischen
Verzeichnissen nach ihm sucht, sollte also nicht schon nach dem ersten Versuch
aufgeben.

 Srpski rjecnik, istolkovan njemackim i latinskim
rijecma, skupio ga i na svijet izdao Vuk Stefanovic
Srpski rjecnik, istolkovan njemackim i latinskim
rijecma, skupio ga i na svijet izdao Vuk Stefanovic
Serbisch-deutsch-lateinisches Wörterbuch
Lexicon Serbico-germanico-latinum
* 1. Aufl. Wien 1818 (P. P. Armenier), LXXII S., 928 Sp.
* 2. Aufl. Wien 1852 (Typis Congregationis Mechitaristicae), 8
Bl., 862 S. (antiqu. EUR 203,-/208,-)
* 3. verb. und verm. Aufl. Belgrad 1898 (Tipopgrafia regni Serbiae), XLII, 880 S.
(antiqu. EUR 280,-)
* Becu 1918, 927 S.
* 4. Aufl. Belgrad 1935 (Tipografia Regni Jugoslavie), 8, 880 S. (antiqu.
EUR 100,-/196,-)
Gedruckt wurden die beiden ersten Auflagen dieses Wörterbuchs in der Druckerei
der Mechitaristen, die 1810 nach Wien gekommen waren. Hier wurden vor allem
Bücher in armenischer Schrift und in anderen orientalischen Sprachen
veröffentlicht. Von der dritten Auflage an ist das Wörterbuch in Serbien
erschienen. Die beiden Titelbilder (links und rechts) stammen von der
zweiten Auflage (Wien 1852).
Nachdruck der Ausgabe von 1818:
* Belgrad 1966 (Prosveta), 71, 925, 270 S.
* Belgrad 1969 (Nolit), 459, 58 S. (antiqu. EUR 18,-/80,-)
* Belgrad 1985 (Prosveta-Nolit), LXXI S., 928 Sp., 58 S.
* Belgrad 1987 (Prosveta), LXXI S., 928 Sp., ISBN: 86-07-00127-2
 Vuk
Karadzic dürfte einer der ganz wenigen Autoren lateinischer Wörterbücher
sein, denen man ein Denkmal gesetzt hat (Bild rechts). Es steht im
Studentenpark von Belgrad und wurde 1937 errichtet.
Vuk
Karadzic dürfte einer der ganz wenigen Autoren lateinischer Wörterbücher
sein, denen man ein Denkmal gesetzt hat (Bild rechts). Es steht im
Studentenpark von Belgrad und wurde 1937 errichtet.
Außer Karadzic soll auch Scheller in Brieg auf diese Weise geehrt worden sein: durch ein Buch am Eingang des evangelischen Friedhofs, das die Aufschrift "Scheller" trägt. Ob dieses Denkmal noch an seinem Platz steht, weiß ich leider nicht.
Aber brauchen unsere Philologen solche Ehrungen überhaupt? Ich meine, jeder von ihnen hat sich sein Denkmal schon selbst gesetzt: durch sein Wörterbuch!
Wenn Sie auf dieser Seite Fehler entdeckt haben oder etwas
hinzufügen möchten, schicken Sie mir bitte eine E-Mail . Ich bin für
jeden Hinweis dankbar!
Falls Sie sich auf meinen Seiten verirrt haben oder ganz einfach
nur zur Begrüßungsseite zurückkehren möchten, dann klicken
Sie bitte hier.